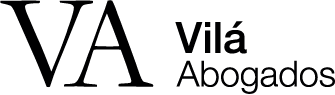In den letzten Monaten haben mehrere Schlagzeilen das Problem des „Greenwashings“ oder Grünfärberei thematisiert. Dabei handelt es sich um eine Praxis, bei der Unternehmen in der Öffentlichkeit ein Bild von Umweltverantwortung vermitteln, welches nicht ihrer Realität entspricht. Kürzliche Fälle, wie die Millionenstrafe gegen das italienische Unternehmen „Shein“ sowie das Vorgehen der französischen Behörden gegen ein Energieunternehmen wegen unbegründeter Umweltversprechen, illustrieren die zunehmend strengere Reaktion der Regulierungsbehörden auf diese Verhaltensweisen. Diese Vorkommnisse sind keine Einzelfälle und beschränken sich nicht auf einen bestimmten Sektor, sondern spiegeln einen weit verbreiteten Trend in der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten wider: die Verschärfung der Kontrollen von Umweltversprechen und die Forderung nach objektiven, transparenten und regulierten Nachweisen, um Verbraucherverwirrung und Wettbewerbsverzerrung zu verhindern.
Greenwashing
Greenwashing hat sich zu einem bedeutenden Phänomen entwickelt, nicht nur im Bereich der Werbung und dem Verbraucherschutz, sondern auch in Bezug auf unternehmerische Nachhaltigkeit und Umweltbesteuerung. Aktuelle Studien zeigen, dass Unternehmen aller Größen, von Großkonzernen bis hin zu KMU, die wissenschaftlich und international festgelegten Maßnahmen zur Emissionsreduzierung nicht erreichen, während gleichzeitig unklare, schlecht belegte oder gar irreführende Umweltversprechen immer häufiger gemacht werden. Als Reaktion darauf haben Regulierungsbehörden die Vorschriften und die Aufsicht verschärft. Sie verordnen, dass Umweltversprechen auf klaren, überprüfbaren und öffentlich zugänglichen Verpflichtungen basieren müssen und verbieten die Verwendung allgemeiner Umweltzeichen, -siegel oder -phrasen ohne fachliche Untermauerung.
Zu den neusten regulatorischen Entwicklungen auf europäischer Ebene zählt die Verabschiedung der Richtlinie (EU) 2024/825 zur Stärkung der Verbraucherrechte im Rahmen der Energiewende. Ihr zentrales Ziel ist es, unbewiesene Umweltversprechen zu verbieten und Verbrauchern Mechanismen zur Erkennung und Meldung von Greenwashing-Praktiken an die Hand zu geben bzw. darüber aufzuklären. Die Richtlinie sieht empfindliche Strafen vor und betrifft auch große Unternehmen. Sie gilt für alle Desinformationen zur Nachhaltigkeit, die Verwendung von Umweltzeichen ohne anerkannte Zertifizierungssysteme sowie das Verschweigen relevanter Informationen über die tatsächlichen Umweltauswirkungen von Produkten und Dienstleistungen. Die öffentliche Bekanntgabe der Sanktionen und der Identität der Gesetzesbrecher ist eine weitere Maßnahme des neuen Rechtsrahmen. Sie trägt zur gezielten Prävention bei, indem sie andere Unternehmen der Branche abschreckt und die Verbraucherrechte schützt.
Greenhushing
Neben Greenwashing ist ein gegensätzliches, aber ebenso besorgniserregendes Phänomen entstanden, das sogenannte „Greenhushing“. Dieser Begriff beschreibt die Tendenz mancher Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsinitiativen und -ziele bewusst zu verschweigen oder zu bagatellisieren, aus Sorge bzw. Angst, des Greenwashings beschuldigt zu werden oder regulatorische Standards nicht vollständig einzuhalten. Obwohl Greenhushing angesichts immer strengerer Vorschriften wie eine intelligente Strategie erscheinen mag, schränkt es tatsächlich die Transparenz ein und behindert den Austausch bewährter Arbeitsweisen im Bereich Nachhaltigkeit. Darüber hinaus kann es bei Verbrauchern und Investoren Misstrauen schüren, da ein Mangel an Engagement oder Verantwortlichkeit wahrgenommen wird. Experten betonen daher die Notwendigkeit, ein Gleichgewicht zu finden: Fortschritte im Umweltschutz sollten transparent und nachvollziehbar kommuniziert werden, gleichzeitig sollten aber sowohl Übertreibungen als auch strategisches Schweigen vermieden werden.
Sanktionsmaßnahmen
Die Herausforderung, Sanktionen durchzusetzen, führt nur zu noch mehr öffentlicher Aufmerksamkeit. Ergänzende Regelungen zu Umweltkennzeichnungen, Wettbewerb und branchenspezifische Vorschriften – wie beispielsweise für den Energiemarkt – schaffen einen Rahmen für Verstöße und Strafen, die Millionen von Euro, Verbote der Auftragsvergabe an die Regierung oder auch die Aussetzung von Genehmigungen und Lizenzen umfassen können. Greenwashing sollte daher nicht nur eine schwere oder sehr schwere Ordnungswidrigkeit darstellen, sondern in bestimmten Fällen auch eine Straftat sein oder zivil- bzw. handelsrechtliche Haftung für Schäden begründen, die Verbrauchern, Wettbewerbern und der Umwelt entstehen.
Der Fall von „Shein“ in Italien, der wegen Greenwashing-Methoden sanktioniert wurde, reiht sich in andere aktuelle Fälle ein, in denen die italienische Regulierungsbehörde den Rückzug unbegründeter Umweltversprechen und die Offenlegung der Wahrheit auf dem Markt gefordert hat. Auch in Frankreich wurde ein Energieunternehmen wegen Fälschung der Umweltmerkmale seiner Produkte mit einer Geldstrafe belegt. Dies verdeutlicht einen gemeinsamen Ansatz, der sich zunehmend in der gesamten Europäischen Union durchsetzt: Umweltinformationen müssen nicht nur wahrheitsgemäß sein, sondern Nachhaltigkeitsverpflichtungen müssen auch zugänglich, öffentlich, nachvollziehbar und von unabhängigen Stellen überprüfbar sein.
Empfehlung für die praktische Umsetzung an Unternehmen
Für Unternehmen ergeben sich aus diesen Beschlüssen klare und unumgängliche Belehrungen: Nachhaltigkeit darf kein Marketinginstrument sein, sondern muss eine nachweisbare Realität darstellen, die mit der Unternehmensstrategie und dem Geschäftsmodell übereinstimmt. Die Einführung von Umwelt-Compliance-Programmen, die Ergänzung unabhängiger Managements und Auditoren (wie z. B. EMAS III- oder ISO 14000-Zertifizierungen) sowie die Überprüfung und Dokumentation aller öffentlich gemachten oder in der Werbung verwendeten Umweltaussagen sind heute unerlässlich, um rechtliche, wirtschaftliche und Reputations- bzw. Imagerisiken im Zusammenhang mit Greenwashing zu vermeiden. Es ist außerdem wichtig zu beachten, dass wiederholtes oder systematisches Greenwashing zu höheren Strafen, dem Ausschluss von öffentlichen Aufträgen, der Rückzahlung unrechtmäßig erlangter Vorteile und der öffentlichen Bloßstellung des betreffenden Unternehmens führen kann.
Diese Anforderungen werden durch den Rahmen des spanischen „Real Decreto 214/2025“ weiter verschärft, welches die Verpflichtungen zur Nachvollziehbarkeit, Transparenz und Verifizierung aller Umweltkommunikationen bekräftigt. Das Dekret sieht unter anderem verstärkte Kontrollen für die Verwendung von Umweltzeichen und -symbolen vor und verpflichtet Unternehmen zur Einrichtung interner Systeme für regelmäßige Kontrollen, um die Übereinstimmung zwischen den öffentlich kommunizierten Informationen und der tatsächlichen Umweltleistung sicherzustellen. Die strikte Einhaltung dieser Maßnahmen ermöglicht nicht nur die objektive Überprüfung der Nachhaltigkeitsmaßnahmen und -Verpflichtungen des Unternehmens, sondern hilft auch, potenzielle Strafen aufgrund von Greenwashing zu vermeiden, indem sie eine nachvollziehbare und transparente Grundlage für alle Umweltaussagen schafft.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der europäische und spanische Rechtsrahmen, Unternehmen nicht nur dazu verpflichtet, die Richtigkeit ihrer Umweltaussagen gewissenhaft zu gewährleisten, sondern auch ein Verantwortungsbewusstsein, Transparenz und Kontrolle im Bereich Nachhaltigkeit zu etablieren. Greenwashing kann heute schwerwiegende und weitreichende Folgen haben, sowohl in Form von Bußgeldern und Marktausschluss als auch eines Vertrauensverlusts bei Verbrauchern und Investoren. Daher ist es ratsam, interne Verfahren und die öffentliche Kommunikation im Zusammenhang mit der Umweltpolitik des Unternehmens proaktiv und kontinuierlich zu überprüfen.
Shameem Hanif Truszkowska
Vilá Abogados
Für weitere Informationen, kontaktieren Sie uns unter:
10 Oktober 2025